Im stimmenstarken Chor all derer, die, kritisch beeindruckt, zustimmend bis aufgewühlt, in jedem Falle herausgefordert, das neue Porträt der Familie von Weizsäcker in dem Buch von
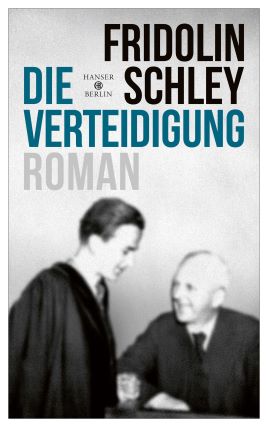
Fridolin Schley, Die Verteidigung, Roman, Verlag Hanser Berlin, 269 S., 24 Euro
gelesen haben, weist keine Stimme auf Enzensbergers „Hammerstein oder Der Eigensinn“ (2008) hin, was aus vielen Gründen nahe gelegen hätte: Deutsche Familiengeschichte in Generationen, hohe Repräsentanzaufgaben in Regierung und Militär, Distanz und Nähe zum NS und Zweiten Weltkrieg, Folgegeschichte BRD – eine Fülle höchst kontrastiver, aufregender Parallelen. „Hammerstein“ erlebte heftige Abfuhren von der Historiker-Zunft (Götz Aly wütete dawider).
Es mag sein, dass Fridolin Schley deswegen für seine Arbeit Roman als Genrebezeichnung nahm, während Enzensberger für Hammerstein „Eine deutsche Geschichte“ gewählt hatte; denn eine Geschichte war es, eine deutsche Geschichte auch… Das Urteil Hammersteins über die Deutschen im NS, 98 Prozent seien „eben besoffen“, wird kaum zu seiner Beliebtheit beigetragen haben. Anders bei den von Weizsäckers, wo ein Untertitel wie „ Der Eigensinn“ undenkbar wäre, greift doch Schley oft zu dem Bild „Er lavierte“. Der Verteidiger Hellmut Becker bedrängte von Weizsäcker, er solle bei der Urteilsverkündigung Überlegenheit zeigen, nicht Überheblichkeit, das führt uns mitten ins Problem, dem sich der Roman von Fridolin Schley widmet: Das – in seinem Schutzverhalten dem Vater gegenüber – so verstörende Selbstbild des Sohnes, das so schwer nachzuvollziehende Verhalten des Vaters. „The United States of America vs. Ernst von Weizsäcker et.al.“ heißt 1946 der Prozess offiziell, er wird auch „Wilhelmstraßenprozess“ und intern “Omnibusprozess“ genannt, weil hinter „et.al.“ bis zu 20 Personen standen. Hellmut Becker hatte als Beistand in die „Verteidigung“ einen Sohn des Angeklagten, Richard von Weizsäcker, hinzugenommen. Es geht also nicht um Schach wie in „Lushins Verteidigung“ (Nabokov), sondern um den Nachfolgeprozess zum Nürnberger Prozess von 1945.
Seit der Apologie des Sokrates von Platon ist der Prozess das Ideal der öffentlichen Wahrheitsfindung. Die (untauglichen) Versuche, einen „Prozess Jesu“ zu rekonstruieren, der „Auschwitzprozess“ (Peter Weiss), nicht zuletzt die „12 Geschworenen“ (Lumet/Fonda) als Glanzstück Hollywoods, zeigen das Drama der Wahrheitssuche als anhaltend aktuell; genial aufgenommen von Franz Kafka, einmal im „Prozess“ und einmal im „Brief an den Vater.“ Schley wollte seinen Text erst „Befragung“ nennen, doch die innere wie äußere Dramatik der Geschichte reichte weiter, dazu war die geistige Situation Deutschlands in den ersten Nachkriegsjahren zu aufregend, ihr prägendes Personal zu bestimmend: Die Herren Wurm, Dibelius und Heuss stützen von Weizsäcker, Margret Boveri schreibt, Robert Kempner klagt an, das Ausland stellt die Kameras auf und der Sohn hilft, den Vater zu verteidigen. Ernst von Weizsäcker, seine Person steht für die Existenzfrage jener Jahre: Widerstanden oder mitgemacht? Es geht um den ranghöchsten Diplomaten eines Unrechtsstaates… Was hat er gewusst, was hat er befördert, hat er mitgemacht? Eine Frage, in der „Deutschland“ sich selbst vor Gericht gestellt sah. „Ich habe nichts mitgemacht, ich habe einen Total-Widerstand geleistet, insgesamt bis an den Rand meiner Möglichkeiten. Das nenne ich nicht mitgemacht.“ Damit ist der Nerv getroffen, damit ist der um Empathie bemühte und immer wieder befremdete Sohn Richard an jedem Prozesstag beschäftigt.
Hier liegt die Stärke des Buches: Sich einfühlen in das Denken, Handeln und Nicht-Handeln, in die Sprache und das Schweigen des geliebten Vaters, sein quälend-unbegreiflicher Ausfall an Empathie in der Menschenfeindlichkeit der NS-Welt, die er als höchster Diplomat des „Reiches“ repräsentierte. Der Sohn leidet an dem so schwer nachvollziehbaren Selbstbild des Vaters, seiner schier unerträglich vernebelnden Diplomatensprache bis in das Labyrinth der nichts und alles aussagenden Mini-Kürzeln. Und da gibt es so viele tödliche Texte, die am Ende ein „W.“ tragen. Julia Encke spitzt es zu (FAZ): „Widerstand durch Mitmachen?“ Soll es das gewesen sein? Eine geniale Lösung, nur dass es einem die Kehle zuschnürt. Im biblischen Hebräisch gibt es nur ein Wort für Kehle und Seele. Widerstand durch Mitmachen! Die emsige Persilschein-Industrie lief an…
Schley erzählt knapp, verdichtet, diskret, fragend-tastend, mit großen Bögen ins „Heute“, setzt an zu atemberaubenden Porträtskizzen, unter denen Hellmut Becker (ab 2. Mai 1937 NSDAP-Mitglied), der in der späteren Bundesrepublik als Bildungspolitiker Karriere machte, am schärfsten gezeichnet ist. Sein Plädoyer gipfelte in den Worten: „Weizsäcker…ein Christ, ein Diplomat im besten Sinne des Wortes, ein wahrer Patriot“. Dass er Thomas Mann ausbürgern wollte, war Becker neben so vielem anderen irgendwie entgangen. Ein Glanzstück für jedes politikwissenschaftliche und historische Hauptseminar! Schleys Buch über Schuld und Unschuld, Opfer und Täter, Moral und Gewissen ist eine fragende Erkundung; sie beginnt mit dem biblischen Satz „Die Wahrheit wird euch frei machen.“ Dank Schleys Arbeit ist wieder darauf zu hoffen.
Am 1. April 1938 war von Weizsäcker in die NSDAP eingetreten, wurde Staatssekretär im Auswärtigen Amt, in die SS aufgenommen, später SSBrigadeführer samt Totenkopf-Ehrenring und SS-Degen – offenbar ein verlässlicher Mann der Macht. Wir wissen nicht präzise, wo er und mit welchen Kenntnissen er den Februar 1933 verbrachte, offiziell Gesandter in Oslo. Ob er vom blitzschnellen Verjagen der deutschen literarischen Elite im Februar 33 nichts erfahren hatte? Den Taliban in Kabul gleich, trieb die neue Macht in wenigen Wochen die tonangebenden Stimmen in Literatur, Theater und Presse in die Flucht, ins Untertauchen, in katastrophische Kälte, zu lesen bei

Uwe Wittstock, Februar 33, Der Winter der Literatur, Verlag C. H. Beck ,
288 S., 24 Euro
„Berlin, 7.2. 1933 – Mein liebes Kind! Grippewelle u. Heil Hitler beherrschen den Markt…die Grippe ist sehr schlimm. Humlis Klasse ist schon 2 Wochen geschlossen, er selbst gesund u. sehr vergnügt ob der Extraferien…ich war letzten Montag im Faust u. schaute in der Pause auf den Gendarmenmarkt hinunter, da zogen unabsehbare Fackelzüge nach den Linden.
Eine Stunde später, in der 2. Pause, zogen sie noch immer. (Wo hatten die Nazis so schnell 20 000 Fackeln her?). Sonst aber herrscht eigentlich Ruhe…“ Betty Scholem schreibt ihrem Sohn Gershom (Gerhard) nach Jerusalem, wie sie den 30. Januar erlebt hat, äußerlich beruhigt, zwischen den Zeilen zittern Ahnungen. (Betty Scholem-Gershom Scholem, Mutter und Sohn im Briefwechsel 1917-1946, C.H. Beck, 579 S.).
Uwe Wittstock erzählt den gesamten 30. Januar unter der Überschrift „Die Hölle regiert“: Joseph Roth nimmt sofort am Morgen den Zug nach Paris, Egon Erwin Kisch trifft in Berlin ein, Klaus Mann verlässt die Stadt, Georg Kaiser und Hermann Kesten lesen die BZ-Schlagzeile „Adolf Hitler, Reichskanzler“, Carl von Ossietzky verlässt die U-Bahn, um sich den Nazi-Rummel anzusehen, Hermann Kesten und Erich Kästner bereden die mögliche Flucht in der Weinstube Schwanneke, Harry Graf Kessler sieht vorm Hotel Kaiserhof die Nazikolonnen marschieren, Hitler befasst sich mit dem Gerücht, Hammerstein wolle gegen Hindenburg putschen…so geht es über Stunden am 30. Januar, präzise literarische Miniaturen in rascher Folge, gleich packenden Filmsequenzen. Wittstock beginnt sein Buch mit einem erzählenden Großphoto vom alljährlichen Presseball am 28. Januar auf dem sich tout Berlin trifft…und endet am 15. März. Besondere Aufmerksamkeit erhalten Else Lasker-Schüler, Ernst Toller, Carl von Ossietzky, Nelly und Heinrich Mann, Thomas Mann, Gottfried Benn, Vicky Baum, Alfred Döblin, Ricarda Huch (!), Gabriele Tergit, Oskar Loerke, Erich Mühsam, Bert Brecht und die wichtigsten Stimmen der Preußischen Akademie der Künste, deren Um-Fall zu den beschämendsten Kapiteln der rigorosen Gleichschaltung gehört. Deutschland hat sich von dem faschistischen Furor im Februar 33 nicht mehr erholt – und Wittstock lässt es miterleben, mithören, mitlesen, aber auch mitaushalten?
Hermann Göring, preußischer Innenminister nannte die Ziele der Naziherrschaft: „Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristische Bedenken. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben, hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts!“ So geschah es. Es gingen so viele, mit Schirm und kleinem Koffer, um nicht aufzufallen…Von Seite zu Seite denkt man: Was geschähe heute in ähnlicher Lage? „Widerstand durch Mitmachen?“ Der „rasenden Verwandlung Deutschlands in eine Hölle aus Diktatur und Terror“ (Sten Nadolny), dem „Winter der Literatur“ , dem „furchtbaren Augenblick“ (Lessing) ist Uwe Wittstock gerecht geworden. Respekt!
Günther Rühle gebührt dieser Respekt in gleicher Weise für seine großartigen Arbeiten zur deutschen Theatergeschichte: „Theater in Deutschland 1887-1945“ , ein Grundlagenwerk. Ohne ihn wären Marieluise Fleißer und Alfred Kerr kaum erkennbar geblieben. 25 Jahre war er prägender Redakteur im FAZ Feuilleton, später beim Tagesspiegel. Frontenwechsler als Intendant in Frankfurt. Respekt soll ihm gezollt werden für etwas Außerordentliches, Unglaubliches, Einmaliges: Ein 96jähriger schreibt ein Tagebuch!
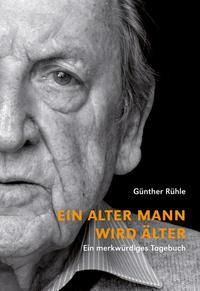
Ein Mensch, der sein Leben mit kritischem Hinsehen, mit dem analytischen Blick auf die Bühne, verbracht hat, verliert die Sehkraft – „trockene Makula“ und die technisch-digitale Welt verliert ihre Konturen. Computertastatur, Radio, Faxgerät, CD-Plattenspieler, Mikrowelle mit ihrer Knopfleiste – „Auftauen“ – das zunehmend tastende Bewegen in der Wohnung, das alles muss bewältigt werden. Kleine Katastrophen zuhauf. Nun sieht er nur noch ein Ziel: „Ich wehrte mich gegen das Veraltern im Alter“, das Gefüttert-Werden, wie es den verehrten, großen klugen Köpfen widerfuhr, Walter Jens und Joachim Kaiser. Nun kämpft er gegen das „Ent…“, entbehren, entsagen, enthalten – bis zum entsorgen? Währenddessen strömen die Erinnerungen an die Kindheit, die Kollegen, die Künste. Er schreibt ein in des Wortes erster Bedeutung „merkwürdiges“ Tagebuch, vom Oktober 2020 bis zum 27. April 2021. Uneitel, voller Anekdoten, mit ironischer Milde, antinarzistisch, verstört, aber klaglos, plötzlichen Kindheitssignalen, alltagsreal: „Seit ich nicht mehr lesen kann, haben die Tage mindestens 47 Stunden.“ „Das Altern ist eine Blüte der Hoffnungen im Zustand des Schrumpfens. Ich habe mich heute in ein Schwimmbecken von Hoffnungen gestürzt und jetzt läuft irgendwo das Wasser weg…“
Gerhard Ahrens hat aus allem ein „Tagebuch“ werden lassen, gerahmt, mit Anmerkungen gestützt und herausgegeben samt einem Nachwort „Der andere Günther Rühle“ – eine des Dankes werte Assistenz! Wie mag es Günther Rühle heute gehen? Er ist Jahrgang ’24…Im Alter nicht veralten! Danke für diesen Anstoß!
Dies Problem besteht für die Autorin, die wir jetzt vorstellen wollen, in keiner Weise! Es heißt, Juden seien Menschen wie alle anderen auch – nur ein wenig mehr. Das ist nicht überheblich, sondern selbstironisch, wie überhaupt kein Volk der Erde sich mit seinem Witz so umfassend über sich selbst lustig macht wie das jüdische. (Das kann auch gefährlich werden, wenn Antisemiten anfangen, jüdische Witze zu benutzen…) Im Alter veralten? Das kann nicht sein für Lizzie Doron, deren so mündliches, so fragendes, so streitendes, so herzzereißendes, so liebendes Buch wir hier vorstellen, nein, Ihnen ans Herz legen wollen.
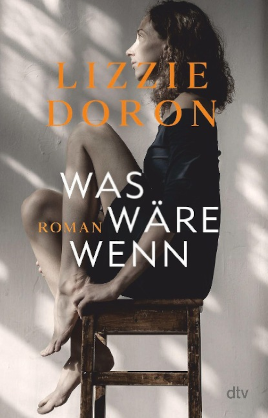
Sie ist 1953 in Tel Aviv geboren (heute mit Zweitwohnsitz in Kreuzberg) und erzählt mit ihrer Lebensgeschichte die Geschichte des Staates Israel. Dieses Viertel in Tel Aviv hat sie geprägt: „…in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin, geht man nicht verloren. Der Mann aus Sobibor kennt die Frau aus Bergen- Belsen gut, und sie bringt mich zu der Frau aus dem Ghetto Krakau, die mich schließlich zu der richtigen Mutter aus Auschwitz zurückbringt.“ Ihre Eltern sind Schoah-Überlebende, vor allem mit der Mutter bringt das Generationenkonflikte. Lizzie – in der Grundschule wurde aus Elisabeth Alisa, später Lizzie – ist träumend-leidenschaftliche Zionistin und gerät mit der Mutter aneinander: „Ein unsagbar schönes Leben liegt vor uns, und nur meine Mutter verdirbt die Stimmung. ‚Was ist denn würdiger als die Heimat?‘, halte ich ihr vor. ‚Wem sonst sollen wir unser Leben widmen?‘ ‚ Wenn…‘, sagt sie, aber ich fahre ihr gleich über den Mund. Ich weiß, sie will sagen, wenn ich im Holocaust gewesen wäre, würde ich sie verstehen. ‚Ist es das, was du willst?‘, stichle ich. ‚Dass ich auch an deinem Holocaust teilnehme?‘ ‚ Die Mutter, traumatisiert, der Erinnerungen voll und von Opfererfahrungen gezeichnet – die Tochter, bereit zu Stärke, Aufbau, Verteidigung und Überlebensenergie – die Generationen dürfen nicht zerreißen! Ein Anruf aus dem Krankenhaus versetzt den Alltag in heftige Schwingungen, Yigal, die frühe und nie ganz vergessene Liebe, liegt im Sterben und bittet um eine letzte Begegnung. Yigal, er war Nähe und Horizont aller Wünsche und Träume, mit dem Zeug zum Generalstabschef und heute Friedensaktivist. Er wird sterben und sie geht aus dem Krankenzimmer, sein „Danke“ im Ohr, und sagt“ ‚Bye‘ – als würden wir uns morgen wiedersehen.“
Damit beginnt das Buch der Erinnerungen, der Lebenskorrekturen, Kriegserlebnisse, der vielen Lebensschwingungen in einem kleinen Land, dem die Schatten der Vergangenheit die Horizonte der Zukunft noch immer nicht leuchten lassen. Lizzie Doron erzählt unbeirrbar, unbezwingbar, unbeeinträchtigt, zutiefst menschlich, geschwisterlich und mit unverwandtem Blick auf eine mögliche Mitarbeit am Frieden. „Wenn ihr es wollt, ist es kein Märchen“, war die zionistische Verheißung, „Was wäre wenn…“ bleibt die Aufgabe.
Hat heute Lizzies Doron eine Zweitwohnung im Westberliner Kreuzberg, weil ihre Mutter noch in Polen von einem Studium in Berlin träumte, so verbindet Barbara Honigmann mit Ostberlin ihre Kindheit, Schulzeit, Studium und erste berufliche Praxis. Ein wenig kennen wir die Ostberliner Situation der Kinder zurückkehrender jüdischer Emigranten aus den Büchern von Irina Liebmann.
Die Eltern kamen als Juden aus englischem Exil zurück und gingen wie selbstverständlich in das „andere Deutschland“ mit seinen kleinen nichtjüdischjüdischen Gruppen. Heute wohnt Barbara Honigmann in Straßburg, deren jüdische Gemeinde ihr wohltut. Welcher Strömung innerhalb des dialogfreudigen Judentums gehört sie an? Liberal ? Modern-orthodox ? Darauf geht sie in einem wunderbaren kleinen Text ihres neuen Buches ein:

Barbara Honigmann, Unverschämt jüdisch, Hanser Verlag, 159 S., 20 Euro
Das Buch sammelt Dankesansprachen, deren Anlass Preisverleihungen waren, von denen sie viele erhalten hat, so viele, dass ein eigener Band sie sammeln konnte. Mit selbstgewisser Mündlichkeit spricht sie über Menschen, Themen und Orte, die mit den Auszeichnungen verbunden waren. Darunter auch den kleinen Text „ Das Problem mit der Kopfbedeckung“. Sie fühlt sich einer Gruppierung nahe, die schomer mitzvot in der Lebenspraxis üben, „ das heißt, uns ohne übertriebenen Eifer darum darum bemühen, die Gebote und Verbote zu beachten.“ Dabei werden sie Grenzgängerinnen zwischen den tonangebenden Traditionen – ein sehr bewusst gelebtes Judentum. Dem entsprechen viele der Reden, mag es um Ricarda Huch oder Elisabeth Langgässer gehen, um Jakob Wassermann oder das Paar Kafka und Proust, um „Erinnerung und Erzählung“, stets steht die Frage nach dem „un-verschämten“ Judentum im Zentrum.
Sartres „ Betrachtungen zur Judenfrage“ waren 1963 bei Ullstein erschienen, das Bändchen wurde von Westnach Ostberlin durchgeschmuggelt und die vierzehnjährige Barbara Honigmann entdeckte, dass der Titel „Juif inauthentique“ mit „verschämter Jude“ übersetzt worden war. „Inauthentique“ ist nicht „verschämt“ – sondern „authentisch“, besser: kräftiger, klarer „un-verschämt“! „Wahrscheinlich ringe ich seit meiner Lektüre dieses Buches als 14jährige damit, mein Judentum, in das ich hineingeboren wurde, un-verschämt zu leben und schließlich, erwachsen geworden, auch so davon zu sprechen, zu erzählen, zu schreiben“. Und angesichts der erworbenen Selbstgewissheit und ausstrahlenden Freude, mit der sie das tut, kann man sich nur verbeugen, ihr zuhören und viel von ihr lernen! Vielleicht auch die charmante Gelassenheit? „1700 Jahre Judentum in Deutschland“ – welch ein Geschenk!
Ein Geschenk in finsteren Tagen ist auch das „Szenario“, das für die Pandemie-Plagen wie gerufen erscheint:

Es ist Pandemiezeit, man bleibt besser zu Hause. Ljudmila Ulitzkaja nutzt die Zeit zum Aufräumen alter Papiere. Da fällt ihr ein Manuskript von 1978 in die Hände, „Tschuma“, heißt es , „Die Pest“ – ein Pestausbruch in Moskau, der dank einer dichten Schweigemauer und des extrem effizienten NKWD nahezu unbekannt geblieben. Der Vater einer Freundin war als Pathologe an den Ereignissen beteiligt – er erzählte davon…und Ulitzkaja als interessierte Genetikerin nahm den Stoff auf, entwarf ein „Szenario“ und bewarb sich damit für einen Drehbuchkurs. Der Text verschwand in der Schublade – bis sie ihn wieder entdeckte, sehr zeit-gerecht, überaus aktuell. Da aber gerade Camus‘ „Pest“ ständig gedruckt wurde, bekam Ulitzkajas „Tschuma“ den Titel „Eine Seuche in der Stadt“; sehr zutreffend und mit dem Wort „Seuche“ dicht an der drohenden Moskauer Katastrophe. Karl Schlögel hat in „Traum und Terror“ die Jahre 1938/39 in der UDSSR mit ihren alptraumhaften Prozessen und Säuberungen beschrieben.
„Schwarze Raben“, die Verhaftungswagen des NKWD fuhren zu vielen Adressen, zu denen der schon Infizierten und zu denen der bald Inhaftierten. Die Prozess-Schatten fallen auch in die Pestbekämpfung. Was war geschehen? Ein Forscher hatte sich, irritiert durch einen Anruf, der ihn nach Moskau beorderte, unversehens angesteckt, war auf der Reise vielen Menschen begegnet, in Moskau mit Kollegen Gespräche geführt, erkrankte augenfällig und allen Beteiligten war klar: Pest! Mit unvorstellbarer Rasanz geschieht nun eine Totalabsperrung, sämtliche denkbare Quarantänemaßnahmen werden ergriffen, die Kontaktverfolgung des Infizierten vollzieht sich mit dem NKWD-Apparat perfekt und hocheffizient. Spätestens jetzt ist es unmöglich, beim Lesen zu unterbrechen. Dann tritt auch ein „Sehr mächtiger Mann mit georgischem Akzent“ auf, der kabarettreif sagt: „Gut! Wir helfen. Bei den Listen und auch bei der Liquidierung‘. Der Volkskommissar erstarrt. ‚Nein, nein, es geht nur um Quarantäne. Nicht um Liquidierung’“ Es gibt groteske wie beklemmende Szenen. Der vollständige Staatsapparat wird vorgeführt, noch immer ein Alptraum. Es gibt Helden, Bösewichte und Ungerührte. Der Text ist keine Blaupause für heute, dennoch geben wir Ljudmila Ulitzkaja das Schlusswort „Die Welt verändert sich auf unvorhersehbare Weise, und ich hoffe, dass diese neue Prüfung…uns nicht noch weiter voneinander trennt, uns nicht noch egoistischer macht, sondern im Gegenteil zu der Ansicht führt, dass es in der globalisierten Welt zu viel Hass und Brutalität gibt und zu wenig Solidarität und Mitgefühl. Das aber hängt von uns ab.“
Ein kleines Geschenk – mit Klugheit und Liebreiz
Eine Geschichte zu erzählen bedeutet, all die Bruchstücke der Welt – Erfahrungen, Träume, unverhoffte Begegnungen, gelungene Zeiten des Glücks – zusammenzufügen. Das gelingt am ehesten mit einem liebevollen Blick, einer behutsamen Zuwendung. Die erste Leistung einer Erzählung ist, dass sie Entferntes herbeiholt. Geschehenes in die Gegenwart holt. Geschieht das bei biblischen Geschichten und wird die größte Unfallursache beim Erzählen, die gute Absicht, vermieden, kommt es zu lebhaften Entdeckungen. Das ist geglückt in dem Band
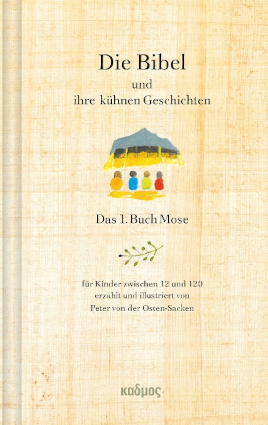
Nacherzählen heißt neu erzählen und so heißt es zu Beginn: „Für Leo, Carlo und Hannah“, Enkel sind oft erste Adressaten…Ein jüdischer Geburtstagsglückwunsch heißt „Auf 120 Jahre!“ – so wird die Erzählung allen Altern empfohlen! Man möchte gleich den Eingang „Der erste Tag der Schöpfung“ zitieren, weil mit dem „Anfang“ schon der erzähllustige, mithörend-fragende, lehrend-heitere, Kenntnis verschenkende, liebevoll-deutende, Antworten erprobende und mit suchbereiterstauntem Humor der Ton angegeben wird. Nie „gute Absichten“, nie fade vorhersehbar, im Gegenteil: mit solidarischer Detektivarbeit beim Begreifenwollen, beim lupennahen Mitlesen ist der Erzähler den Mithörenden nahe und weiß manchmal selber nicht, was „hat es zu bedeuten“. Der Erzähler als Mithörer, der nie das Perfekt wählt und damit alles weiß, sondern das Im-perfekte, das Unabgeschlossene scheint ihn wie die Lesenden nicht loszulassen. Da gibt es bei den sieben Schöpfungstagen so viel zum Kopfschütteln und Kopfnicken, Kopfsenken und Kopfheben, dass man nur rufen kannn: „einen Einser für den Schöpfer der Welt!“ Es wird auch oft leise beim Erzählen, ein verschwebendes Schweigen…Man hat gesagt, Literatur gründe auf liebevoller Zuneigung, ja, und hier kommen die von Behutsamkeit erfüllten, zärtlich hingetupften, dazwischen geschubsten Illustrationen hinzu, die vieles anschaubar, ansehnlich machen. Der Ordinarius, der „Hoch“-schullehrer für Neues Testament und Jüdische Studien, verlässt seinen Lehrstuhl und setzt sich in den Kreis jüngerer und älterer Zeitgenossen, hört mit, denkt mit und teilt mit – hier und da aus dem Schatz des Erlernten – zu Nutzen und großer Freude aller Generation.