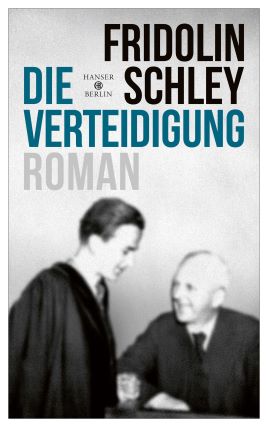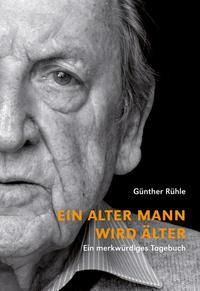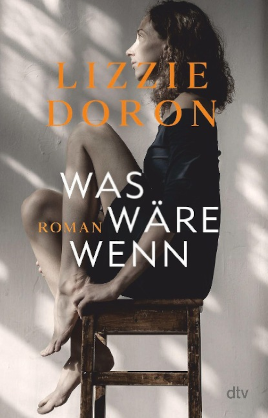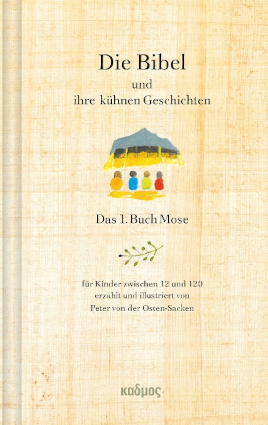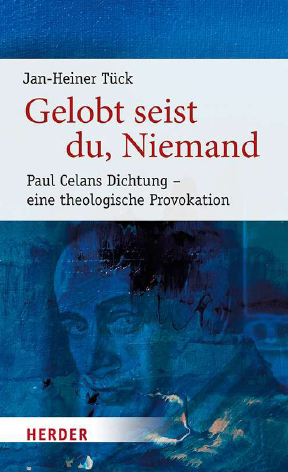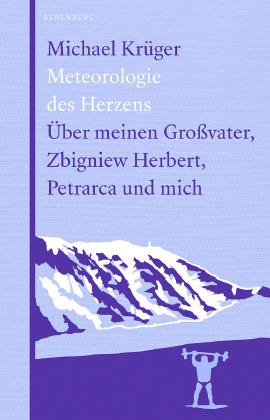„Lesen schärft die Fähigkeit, die Welt zu verstehen, in ihrer Vielfalt und Komplexität. Auf Französisch bestehen die Wörter ‚lire‘ (lesen) und ‚lier‘ (verbinden) aus denselben Buchstaben. Lesen führt einen zu sich selbst zurück. Lesen, um sich selbst zu lesen. Lesen ist die freieste kulturelle Tätigkeit, die es gibt.“ Annie Ernaux
Man kann es leicht und mit schwingender Eleganz sagen und man kann es schwer mit gewichtiger Bedeutsamkeit sagen: „Wir sind von Haus aus eine geschwätzig plappernde Spezies – kommunikativ vergesellschaftete Subjekte, die ihr Leben nur in Netzwerken erhalten, die von Sprachgeräuschen vibrieren.“ Jürgen Habermas
Nur zwei kleine Fundstücke aus dem an Medaillons reichen Band von
Katharina Raabe, Frank Wegner (Hrsg.): Warum lesen. Mindestens 24 Gründe. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020, 347 Seiten, 22 Euro
Ein Geschenk, das sich der Verlag zum 70. Geburtstag selbst bereitet hat, doch über den Anlass hinaus auch zur rechten Zeit vorlegt, worauf das Nachwort anspielt „Lesen ist eine Überlebenstechnik. In Krisenzeiten sind Menschen, die lesen, im Vorteil….Krisenzeiten können sich als Ernstfall für die veränderte Kraft des Lesens erweisen. Das Erzählen wie das Denken erfordern Zeit und Konzentration. Kraft sich etwas vorzustellen und zu vergegenwärtigen. Wie jemand liest, sagt etwas darüber aus, wie sie oder er lebt, die lesende Person ist versucht zu sagen: Ich bin das, was ich gelesen habe…Wie aber kommt es dazu?“
Darauf antworten Autorinnen – mit mehr als 24 Gründen! – und Autoren in großer Stimmenvielfalt.
Annie Ernaux, Katja Petrowskaja, Eva Illouz, Esther Kinsky, Jürgen Habermas, Dzevad Karahasan, Maria Stepanova, Hartmut Rosa, Hans Joas, Alejandro Zambra und viele mehr aus Berlin, Wien, Jerusalem, Moskau, Charkiv und…
Lesen und Leben, ein Buchstabe – trennt er, verbindet er? Führt er zu einem Gespräch?
„Es wird erst vorbei sein, wenn wir reden“, gleich einem Wasserzeichen im Papier, einer
wiederkehrenden Musik, eines ständig mitgehenden Tones, ist dieser Satz die Melodie eines großen Buches, in dem das Erzählen gegen den Tod mit einer hochliterarischen Friedensbotschaft geübt, entfaltet und, ja, selbst noch gelernt wird:
Colum McCann, Apeirogon, Roman, 608 S., Rowohlt Verlag, Hamburg 2020, Geb. Ausgabe
25 Euro
Was wird vorbei sein? Wer sind „wir“?, Worüber reden? Und: Wo beginnen ? Der Erzähler – ein liebevoller Erzähler – greift zur ältesten und modernsten Erzählweise: einem kunstvollen Gewebe aus Tausendundeiner Nacht, Bibel, Koran und Kafka – eine Rahmenhandlung mit Schachtelgeschichten und er nennt das alles: „Apeirogon“, kein eingängiger, aber sehr angemessener Titel: Apeirogon, eine Figur mit einer zählbar unendliche Menge Seiten, zusammengesetzt aus den griechischen Wörtern für „unendlich“ und „Winkel“, bildlich zu erkennen als eine unendliche Menge von Rauten, die sich in leichten Versatz ohne Ende wiederholen.
Diese geometrische Erzählfigur vermag nun das unzugänglichste, verminteste und intrikateste Erzählgebiet gegenwärtiger Literatur herantastend zu beschreiben: den israelisch-palästinensichen Konflikt. Der „wird erst vorbei sein, wenn wir reden..“ Zwei haben das unter Schmerzen begonnen:
Rami Elhanan, Jude, Israeli, Jerusalemer, Vater von Smadar, die mit 13 Jahren von einem palästinensischen Selbstmordattentäter ermordet wurde, und Bassim Aramin, Moslem, Palästineneser und Vater von Abir, die mit 10 Jahren von einem israelischen Grenzschützer erschossen wurde. Beide sind keine fiktiven Figuren, der Erzähler hat sie kennengelernt und die Erlaubnis erhalten, ihre Geschichten, ihre Welt, ihre Erfahrungen und ihre Friedensarbeit zu erzählen. Die Väter der toten Töchter werden nun „Brüder“in dieser Welt der Scharfschützen, fliegenden Checkpoints, Dauerkontrollen, Mauern, Alarmsirenen, Notkeller, Steinehagel und Zerrissenheiten von morgens bis abends. Das Buch erzählt den einzigen sinnvollen Ansatz, nämlich auf das Siegen-Müssen zu verzichten, in 1001 Kapiteln: 1-499, in denen Rami mit seinem Motorrad zu einem gemeinsamen Treffen; 499 -1, in denen Bassim auf dem Rückweg ist. Im Kapitel 500 in der Mitte erzählen beide ihre Geschichte, unterstützt von bewegenden Bildern. Kapitel 1001 erzählt die Entstehung.
In den „Schachtelgeschichten“ wird viel zusammengetragen von den Vogelzügen über dem Westjordanland, es gibt Erzählbögen von Theresienstadt nach Jerusalem, von Hamburg nach Beit Jala, der Schule Talita Kumi und dem Kloster Cremisan, Kluges über islamische Ästhetik und biblische Erzelterngeschichten, hundertfältige Facetten der Schoah, traumatische Erinnerungen an die Nakba. Rami und Bassam hätten allen Grund sich zu hassen – sie werden Mitglieder der Combatants of Peace -ihre verstorbenen Töchter weisen sie in ein anderes Leben, jenseits von Steinschleudern und Plutoniumskernen.
Mehr als 5 Jahre hat Colum McCann an diesem unbeschreiblichen Meisterwerk gearbeitet. Er kannte noch nicht die neuen trumpgestützten Verknüpfungen zwischen Israel und den arabischen Staaten, aufgrund deren die Palästinenser Totalverlierer sind. Seltsam, das Buch erschien im Februar 2020 in den USA, kurz vor dem Aufflammen der „Black Lives Matters“-Proteste..Man kann es nicht zusammenfassen; es ist ein uneingeschüchterter Appell zur Freundschaft über politisch-religöse Grenzen hinweg, ein Lehrbuch über den Verzicht auf das Siegen-Müssen, Von Rami heißt es: „Er wollte die Zuhörer wachrütteln. Eine Regung sehen. Nur kurz. Ein sich öffnendes Auge. Das genügte schon. Einen Riss in der Mauer. Den Anflug eines Zweifels. Irgendetwas.“
„Es wird erst aufhören, wenn wir reden“ – was hier zwei Völker betrifft, trifft in gleicher Dringlichkeit für drei Frauen zu aus drei Generationen: David Grossmann erzählt die Lebens- und Leidensgeschichte der Eva Panic-Nahir, ihrer Tochter und ihrer Enkelin – wieder wie bei Colum Mc Cann, die Vergegenwärtigung von Lebensgeschichten, vorstellbar verkörpert in literarischer Gestalt wie Rami und Bassim, nun Vera, Nina und Gili.
David Grossmann, Was Nina wusste, Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, Hanser Verlag, München, 2020, 251 S., 25 Euro
„Was Nina wusste“ ist der Schmerzkern des Buches, das in einem innerfamiliären Minenfeld versucht, drei Generationen eine Sprache zu geben die spontan und verhalten zur gleichen Zeit ist.
Wer andere Darstellungen hinzu nehmen will: „ A naked Life“, Videogespräche von Danilo Kisch mit Eva Panic-Nahir (1089) und „Eva – A Documentary“ (2003), auf Youtube erreichbar. Allen gemeinsam ist die Rückkehr an den Tatort Goli Otok, Titos Sträflingsinsel, die Hölle in der Adria. ( Eine kroatische Pflegekraft, von mir persönlich befragt, stieß ein „Böser Ort“ hervor, sagte kein weiteres Wort).
Was wusste Nina? 1951, nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin, wurde ihr Vater wegen „stalinistischer Umtriebe“ verhaftet, gefoltert und in den Selbstmord getrieben. Ihre Mutter, Eva, wird vom kroatischen Geheimdienst erpresst; sie soll ihren geliebten Mann als Verräter brandmarken; so wird sie ihr Leben retten und mit ihrer Tochter in Freiheit leben. Verweigert sie dies, wartet Goli Otok auf sie und für die sechsjährige Tochter Nina „die Straße“…Und – sie entscheidet sich für ihren Mann und gibt die Tochter preis. Eva Panic-Nahir hat David Grossmann gebeten, diese „Familienvorstellung mit Dämonen“ (Axel Rühle) zu erzählen…Und er lässt dies beginnen am 90. Geburtstag Evas/Veras im Kibbutz, denn sie ist nach der „Hölle“ nach Israel ausgewandert, wo die Generationen wieder zusammenfinden. An diesem 90. Geburtstag beschließen sie, das bisher Verschwiegene, Verdrängte und Erstickte auf einer Reise nach Goli Otok zu erinnern, ja, zu „erlösen“.
Zwei Bemerkungen zum Schluss neben der Versicherung, dass der Roman (?) schier alles enthält –
Kriegsberichte, Liebesepisoden, Familienzwiste, humorvolle Gefechte – die Lagererinnerungen werden in einer „dokumentierend-amtlich“ wirkenden Schriftart gedruckt, was die Intensität erhöht. Ein weiteres Wunder dieses Buches vollbringt die Übersetzerin Anne Birkenhauer. Jeden Anklang an ein schreckliches „Jiddisch-Idiom“ vermeidend, gewinnt sie ein Deutsch für die wohl kroatisch-jüdisch radebrechende Vera, das das Herz berührt – eine Meisterinnenarbeit!
„ Es wird erst vorbei sein, wenn wir reden“ – und wie sie reden: Vera, Nina, Gili, Grossmann, Birkenhauer – und wir haben das Glück, zuzuhören.
Einander zuhören, zueinander gehören, davon erzählt ein Roman, dessen Anfangszeilen lauten:
„Lassen Sie uns zusammenfassen, sagte der Neurologe.
Ja, bitte, flüstern beide.
Die Beschwerden sind nicht vollkommen gegenstandslos. Es hat sich tasächlich auf eiem der Frontallappen eine Atrophie gefunden, die für eine leichte Neurodegeneration spricht.
Wo genau?
Hier auf der Hirnrinde.
Es tut mir leid, aber ich sehe nichts.
Seine Frau beugt sich über die Aufnahme. Ja, da ist etwas Dunkles, sagt sie, aber klein.
Stimmt, klein, bestätigt der Neurologe, aber es kann sich ausweiten.“
Der Roman beginnt: Das Paar, die Demenz und die Zukunft.
Abraham B. Yehoshua, Der Tunnel, Roman, Nagel & Kimche Verlag, München 2019,
367 S., Aus dem Hebräischen von Markus Lemke, 24 Euro
„Lassen sie uns zusammenfassen“, „ ‚Bitte‘, flüstern beide“, das kann auch nicht anders sein, waren sie doch 56 Jahre verheiratet, der Schriftsteller und seine Frau, die Kinderärztin, immer etwas realitätstüchtiger als er; sie sieht ja auch den kleinen schwarzen Punkt, die „Atrophie“, wie es im ablenkenden Ärztelatein heißt, konkreter: die Demenz oder im Yehoshua-Ton, den einsetzenden Sinkflug des Vergessens. Sie sieht ja auch, wie er aus der Kita den falschen Enkel abholt, nimmt wahr, dass er den Parkplatz vom Auto nicht findet und immer häufiger anderer Leute Vornamen vergisst. Er verläuft sich im Theater und landet schließlich auf der Bühne und geht im Krankenhaus ständig ins falsche Zimmer, kauft auf dem Wochenmarkt und im Supermarkt erst doppelt, dann dreifach Tomaten ein. Demenz – vor dieser Auskunft hat jeder Angst.
„…es kann sich ausweiten, sagt der Neurologe.
Kann es …oder wird es?
Es kann und wird wahrscheinlich.“
Und die Erzählung beginnt…Sie geht mitten in Israels gegenwärtige Geschichte, sie geht mitten in den Demenzverlauf, doch, dreimal unterstrichen: Es ist eine große Liebesgeschichte! „Ich wollte zeigen, dass Ehen auch halten können“, sagte Grossmann in einem Interview. Die Dialoge zwischen dem Paar sind eine einzige Wohltat – es gibt von dieser Literatur so wenig! Und eine weitere Wohltat ist zu lesen, dass viele Israelis kranke Kinder und schwache Alte, Kranke an den Demarkationslinien zu den besetzten Gebieten mit Autos abholen und in ein Krankenhaus bringen und nach Behandlungen wieder zurückfahren. Überhaupt das Krankenhaus: Ein Ort, wo Palästinenser und Israelis gut zusammen arbeiten. Das Krankenhaus – ein Ort der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens, das habe immer funktioniert, sagt der Autor.
Und er gibt sehr vorsichtig-nachdenkliche Anstöße zur Demenz, privat, politisch, pragmatisch. Seine Frau (wieder sie!) fädelt ihn in ein Bauprojekt ein – er war landesweit verantwortlich für Straßenbau – das er mit seinem jungen Nachfolger in der Wüste beginnt, womit „der Tunnel“ ins Spiel kommt, ein so abenteuerliches Projekt, das man aus dem Staunen über Phantasie, Humor, Menschenliebe nicht mehr herauskommt. Seinem Buch gibt Yehoshua die Widmung:
„ Für meine Ika (1940-2016). Unendliche Liebe.“, denn er ist der „liebevolle Erzähler“. Seine Literatur gründet auf liebevoller Zuneigung. Zuneigung – die bescheidenste Form der Liebe, Sie zeigt die Menschen in ihrer Welt ineinander verbunden, voneinander abhängend, zusammen wirkend. Ein Vor-Geschmack dessen, was sein könnte.
Was sein konnte erinnernd vergegenwärtigen und nachträumend am Rand von Tag und Nacht, Schlaf und Wachsein, wieder bewusst werden lassen, durchzieht das neue Buch von
Gertud Leutenegger, Späte Gäste, Suhrkamp 2020, 175 S., 22 Euro
Es entzieht sich rascher Wahrnehmung, prompt nachvollziehendem, auch sympathetischem Einverständnis. Mir kamen als Annäherung nur die unbestimmt-wilden Töne, Spiele und Bilder der Schweizer Fasnachts-Traditionen in den Sinn, zum Beispiel die Luzerner Guugenmusig, ein wahres Dämonium an Masken, Gewändern und Musiken mit ihrer dumpftrommelnden und schrillschmerzenden Guugenmusig. Dem Höllenschlund entstiegen, ziehen fürchterliche Blechbläser, Tubaröhrer, Piccoloflötenschriller, Trompetenbläser und wirre Dudelsackpfeifer durch die nächtliche Finsternis. Ihr Clou liegt darin, die erwartbaren Töne virtuos zu verpassen, exakt daneben zu tömen und mit immer neuen Anläufen in dräuender Klangfülle schmerzlich am Rand vorbei zu spielen.
Ein wenig von dieser vernebelnden Unfassbarkeit, dominanten Undeutlichkeit, exakten Unschärfe, sensiblen Verschwommenheit liegt über dem Buch: Die Erzählerin kehrt in ihre Heimat– so beklemmend wie vertraut – an der schweizerisch-italienischen Grenze im Tessin zurück, um Orion – Ehemann, Freund, Vater ihres Kindes, Lebensgefährte? – zur letzten Ruhe zu geleiten, unruhig war er ein Leben lang. Sie sucht das vertraute unverschlossene, aber menschenleere alte Hotel auf und eine Nacht der Erscheinungen hebt an, in der, der Fasnacht gleich, eine Fülle seltsamer Figuren auftauchen, darunter Flüchtlinge, die auf überfüllten Schlauchbooten sich an die Küste Siziliens
retteten und sich jetzt im unwegsamen Zwischen-Grenzgebiet sammeln, die „späten Gäste“…
Alles spielt in einem einem Grenzgebiet, zwischen den Ländern, den Erinnerungen, zwischen Tag und Nacht, Wachsein und Schlaf. Orion, sein Leben verschwebt und bleibt schwer entzifferbar.
„Es dunkelt schon, als ich den ovalen Platz unter den Bäumen betrete, nichts rührt sich In der Tiefe liegt über der Lombardei ein von diffusen Lichtern erhellter Nebelschleier…“
Vielleicht noch bei Christa Wolf gibt es diese Aufforderung, sich einzulassen auf die Erzählerin ihr i Nachdenken und Erinnern, sich selbst dem Leben auszusetzen mit seinen karnevalesken Zügen, mitzudenken beim inneren Gespräch. „Jahre vergehen, und die Zeit heilt nichts.Sie macht uns nur mutig, unsere Erschütterungen zu tragen.“ Ein Buch, „zwischen den Jahren“ zu lesen…
Ein ganz anderer Jahrestag wurde Ende Oktober in Moskau, St. Petersburg und Woronesch gefeiert:
Iwan Bunins 150. Geburtstag; Anlass für den Dörlemann-Verlag, einen weiteren Erzählungsband seiner Bunin-Gesamtausgabe (neun Bände seit 2003) hinzuzufügen:
Iwan Bunin, Leichter Atem, Erzählungen 1916-1919, Deutsch von Dorothea Trottenberg, herausgegeben von Thomas Grob, Dörlemann Verlag, Zürich, 287 S., 25 Euro
Präsident Putins Erlass, ein respektvolles Gedenken des ausgesprochenen Revolutionsgegners – er floh 1920 mit einem der letzten Schiffe von Odessa nach Frankreich – einzuberufen, war zumindest verblüffend, fand bei uns kaum ein Echo, von einigen Lesungen abgesehen. Bunin in einer Ausstellung auf dem Roten Platz? Er habe einen „herausragenden Beitrag zur russischen und zur Weltliteratur“ getan, so das Staatsoberhaupt. In der Russischen Staatsbibliothek für Kinder gibt es einen Wettbewerb „Grammatik der Liebe“…
Nun war Bunin um die Jahrhundertwende ein geliebter und verehrter Autor, befreundet mit Maxim Gorki, bewundert und zum Lehrer erhoben von Vladimir Nabokov, mehrfacher Träger des Puschkin-Preises, Ehrenmitglied der Russischen Akademie – eine Stimme Russlands, die nach 1917 verstummte, ja erstickte, denn er nahm die Revolution wahr als eine „Orgie des Todes“. Er liebte das alte Russland, seine Dörfer, seine Menschen – er zerbrach an der Gewalt der Umbrüche, die das Dorf und seine Schenken, Bahnhöfe und Jahrmärkte zerstörten. Er blieb in seiner zärtlichen melancholisch-impressionistischen, bezaubernden Sprache und hielt nichts von den neuen Lautexperimenten etwa des Daniil Charms. 1933 erhält er erster Russe den Nobelpreis für Literatur, da lebt er schon lange in gro0er Existenznot in Paris. Verarmt, vereinsamt, sieht er voller Entsetzen auf die stalinistische Barbarei, die ihn auch 1945, obwohl von Freunden gebeten, gedrängt, erwartet, an der Rückkehr in die Sowjetunion hindert. 1953 stirbt er in Paris -erschöpft von all dem Schrecklichen, was er erlebt hat und von all dem Wunderschönen, was er geschrieben hat.
Darum bemüht sich der Schweizer Dörlemann Verlag, der jetzt die Arbeiten aus den schmerzlichen Jahren des Krieges 1916-1919 vorstellt. Die titelgebende Erzählung ist eine wunderbar leichtsinnige, subtil erotische Geschichte, weit aus schwingende Lebenslust und Melancholie lassen den „leichten Atem“ und die „kalte Frühlingsluft“ nebeneinander atmen. Fatale Affären gibt es noch einige, immer mit malender Sprache erzählt – das müsste unübersetzbar sein, denkt man unwillkürlich…Ein kluges Nachwort ergänzt die brillianten Übersetzungen. Der Band ist angenehm ausgestattet, eine Studie von Kandinsky „Moskau, Zubovskaja Platz (1918)“ auf dem Einband ist ein Geschenk für sich. Ein fern gewordener, kein verlorener Sohn Russlands malt die vorrevolutionäe Zeit verführerisch schön. Olga Martynova erinnert an Bunins Wort „Amata nobis quantum amabitur nulla!“, deutsch: „Wie sie geliebt wurde, keine wird mehr so geliebt!“ Im Russischen ist Russland weiblich….
Den vorhergehenden Band in der Gesamtausgabe empfehlen wir gleichfalls:
Iwan Bunin, Ein Herr aus San Francisco, Erzählungen 1914-1915, Aus dem Russischen übersetzt von Dorothea Trottenberg, 2017, 240 S., 25 Euro
Bunin wieder lesen – das ist ein glücklicher Gewinn, einen Autor wieder finden aus Stille und Vergessenheit, das ist ein glücklicher Fund! Wir verdanken der 2017 Litauen gewidmeten Buchmesse die Begegnung mit dem zwischen Kaunas und New York „hangenden“ Erzähler Antanas Skema, lange verstummt und vergessen – nun wieder zum Lesen präsent:
Antanas Skema, Das weiße Leintuch, Aus dem Litauischen von Claudia Sinnig, Guggolz Verlag, Berlin, 2017, 265 Seiten, 21 Euro, mit einem Nachwort von Jonas Mekas
Antanas Skema, Apokalyptische Variationen, Prosastücke, Aus dem Litauischen von Claudia Sinnig, Guggolz Verlag, Berlin, 2020, 425 Seiten, 25 Euro, Anmerkungen, Biographie und einem Essay zum Autor von Claudia Sinnig
„Ein Litauer in New York“, könnte man auch titeln. denn das geräuschvolle New York von John Dos Passos und Upton Sinclair, George Gershwin und Fred Astaire vermischt sich mit dem Lärmen der Märkte in Kaunas und Wilna. Die hart hämmmernde Musik Amerikas und die weich romantischen Melodien seiner litauischen Heimat erfüllen Herz und Ohren. Skema verwandelt das Exilleben in hinreißende Literatur. Einem jüngeren Bruder des Ulysses von James Joyce gleich, bewegt er sich durch die Metropole Amerikas, setzt einen atemlos modernen Roman aus sich heraus, ironisch, musikalisch, schnell, verblüffend unsentimental, ernst. Der nach verschlungenen Fluchten aus Litauen in deutschen Camps für Displaced Persons lebte, von dort 1949 den Weg ins New Yorker Exil fand, nimmt den Charakter einer displaced person an:
Er arbeitet als Liftboy in einem großen Hotel, erneut jüngerer Bruder geworden, diesmal des Sisyphos mit seinem up and down, up and own, unablässig, Tür auf, Tür zu, steigt ein, steigt aus…Ein vierzigjähriger Liftboy, steigend, fallend, mit einer großen Liebe für Albert Camus, den Sisyphoskenner…Beide sterben bei Autounfällen, displaced persons auch im Tode.
Und immer wieder litauische Volkslieder, Kindheitsbilder. Was bewahrt ihn vor dem Absturz ins Bodenlose? Ein „weißes Leintuch“. Während der sowjetischen Besatzung wurde er nicht gedruckt, seine Literatur galt als „reaktionär und formalistisch“. Die letzte Seite des Buches „Das weiße Leintuch“ ist ein Porträtbild, wie Jonas Mekas ihn sah: Eleganter Landstreicher im weiten Mantel mit weiten Hosen, schon New York, noch Wilna; Spieler, Sänger, Schreiber, stilbewusst, frei und nachdenklich.
Dank dem Guggolz-Verlag und seinem Gespür für verlorenen gegangene Literatur, Dank an Claudia Sinnig für die Übersetzung und die liebevolle Textannäherung!
Eines ist allen diesen Büchern gemeinsam: ihre „Mächtigen Gefühle“. Das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin verantwortet einen eigenen Forschungsbereich, der sich der Geschichte der Gefühle widmet. Die Leiterin dieses – ozeanischen ! – Forschungsfeldes, Ute Frevert, hat jüngst eine Ausstellung für die Öffentlichkeit präsentiert, die das Panorama der deutschen Gefühlspolitik im 20. Ja hrhundert entfaltet. Daraus ist ein Buch entstanden:
Ute Frevert, Mächtige Gefühle, Von A wie Angst bis Z wie Zuwendung. Deutsche Geschichte seit 1900, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2020, 496 Seiten, 28 Euro
Läge es jetzt nicht vor, man hätte darum bitten müssen, denn nicht nur Titel wie „Krebs fühlen“ von Bettina Hitzer oder „Republik der Angst“ von Frank Biess oder die rasch auftauchenden Arbeiten jeglicher Couleur zur Virus-Krise zeigen, wie mächtig wir alle zur Zeit durchgeschüttelt werden von Empfindungen, Ängsten, Schocks und Verunsicherungen. Je mehr von coolness geredet wird, je erstrebenswerter cool zu sein scheint, desto allmächtiger scheint sein Gegenteil uns zu dominieren.
Angesichts der Corona-Leugnung und ihrer verwirrten Deutungen erscheint der Klageruf: „Was hat die Menschheit seit 100 Jahren gelernt?“ nachvollziehbar. Es kann gut sein, dass das Max-Planck-Institut für Bildungsforschung gebeten werden muss, einen Forschungsbereich zu eröffnen: Die Macht der Dummheit“.
Gefühle zeigen, Gefühle nicht zeigen – im Nu ist ein Lebenslauf, eine Karriere, eine Wahl, ein Urteil entschieden. Ute Frevert hat 20 „Mächtige Gefühle“ herausgestellt und ist ihnen in der deutschen Geschichte nachgegangen – ein großes Magazin, dessen Fächer reich gefüllt sind und die nach Erfahrung und Interesse mit Zitaten, Kontexten und Bildern geöffnet werden können – der Ausstellung mit 20 großen Tafeln gleich. Meine Neugier richtete sich zuerst auf Hass, Wut, Stolz und Neid, um politische Phänomene hier und anderswo besser in den Blick zu bekommen. Demut, Geborgenheit, Solidarität, Vertrauen, Zuneigung, Freude in der deutschen Geschichte seit 1900
werden mit ihren erschreckenden Ambivalenzen entfaltet. Die restlichen seinen genannt: Angst, Ehre, Ekel, Empathie, Hoffnung, Liebe, Neugier, Nostalgie, Scham und Trauer..
Jedes dieser Gefühle füllte Regale, nähmen wir weitere Ebenen dazu wie Bildende Kunst und Musik. In einer bekömmlichen didaktischen Reduktion (!) breitet die Autorin einen Fächer der Gefühle aus, der zum Weiterlesen, zum Gespräch-Eröffnen, zu seminaristischen Runde im freundlichen Kreis einlädt. Über 50 Seiten Anmerkungen erweitern und vertiefen die historischen Anstöße. Eins sei noch angemerkt: Ist „Guernica“ von Pablo Picasso das Bild der 20. Jahrhunderts für Europa, so das Photo des knienden Willy Brandt im ehemaligen Warschauer Ghetto das Gefühls-Bild der Deutschen Geschichte seit 1900…
Ute Frevert eröffnet ihre Reihe der Gefühle mit Angst. Sie hätte gleich wieder abbrechen können und von einem Haus in Berlin-Nikolassee erzählen, in dem die Angst das Atmen schwer werden ließ und den Einwohnern, die mit dem Theater, dem Schauspiel, der künstlerischen Darstellung sehr vertraut waren, dennoch keine Gelegenheit bot, die Angst zu „überspielen. Davon erzählt
Thomas Blubacher, Das Haus am Waldsängerpfad. Wie Friedrich Wistens Fanilie in Berlin die NS-Zeit überlebte, Berenberg Verlag, Berlin, 2020, 189 Seiten, 20 Euro
Heinz Knoblochs Eröffnung seines Moses-Mendelssohn-Buch mit der Mahnung „Misstraut den Grünflächen!“ und den klugen amerikanischen Appell „Dig, where you stand! “ haben wir noch im Ohr als Aufforderung, historische Forschung in der Nähe zu beginnen. Hier müsste man sagen: „Mach die Augen auf und sieh!“. Da steht das verwirrende, so eigenwillig wie schöne Haus im Waldsängerpfad Nr. 3 nahe dem Nikolassee. Vor dem Kauf wurde abgeraten: „Es wird ihnen nicht gefallen, es ist so entartet.“ Große Köpfe des Bauhauses hatten es gebaut und eingerichtet: Peter Behrens und Marcel Breuer. Der Bauherr, der Psychologe Kurt Levin, unterbrach seine Rückreise von einer Gastprofessur in den USA, als er von der Machtübergabe an Nazis hörte und ließ Berlin Berlin sein. Die Ehefrau des Stuttgarter Theatermannes Fritz Wisten, Trude, erwarb das Haus: sie und ihr Mann, im Unrechtsjargon der Nazis, eine „privilegierte Mischehe“, mit zwei „Mischlingen ersten Grades“, ihren Töchtern Eva und Susanne, zogen ein – in ein Ghetto und eine Rettungsinsel.
Die Nachbarschaft bot Personal für einen Alptraum: „Reichsfrauenführerin“ Scholtz-Klink wohnte in der Nähe ebenso wie der Leiter Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, Walter Gross.
Unterdessen war Fritz Wisten in die Leitung des Jüdischen Kulturbundes berufen, der von Nazis Gnaden jüdisches Theater für das jüdische Berlin spielen durfte. Mit der Pogromnacht 1938 veränderte sich das Leben völlig: Aufführungsverbote, misslungene Emigrationsversuche, Haftaufenthalte, das Leben wurde unaufhaltsam zugeschnürt…
Am 26. April 1945 erschienen Russen im Berliner Süden – das Atmen wurde wieder leichter. Thomas Blubacher, Schweizer Theaterhistoriker (Monographie über Gustaf Gründgens) dokumentiert auch die Ost-Berliner Theatergeschichte Fritz Wistens, die „Theater“ mit Kollegen und der SED, wobei er immer Grenzgänger blieb, denn er gab das schöne Haus im Waldsängerpfad bis zu seinem Tod 1962 nie auf – ein hausgroßer, diesmal besonders schöner Stolperstein. Da steht er mit blendend weißer Fassade; nun können wir eine bewegende Überlebensgeschichte im „Hausbuch“ lesen. Es gibt Zeugnis vieler Gefühle, Trauer, Geborgenheit, Solidarität und Hoffnung gehörten gewiss dazu. Und Zuneigung
Von dem bescheidensten und liebenswürdigsten Haushalter deutscher Gefühle in der Literatur mussten wir uns am Anfang Oktober des Jahres verabschieden: Günter de Bruyn, 93 Jahre alt geworden in seiner „märkischen“ Heimat, der er mit gediegener Akribie („Unter den Linden“) und verhaltener Liebe („Mein Brandenburg“) viele Geschenke in Zuneigung übereignete. Der Romancier („Buridans Esel“, „Neue Herrlichkeit“, Märkische Forschungen“) verstand es, mit diskreter Souveränität der DDR einen Spiegel vorzuhalten, von dem nicht eindeutig klar ist, ob sie ihn wahrzunehmen verstand. „Märkische Forschungen“, das Buch wie die Verfilmung, waren DDR-Forschungen, vielleicht das kritischste Buch zu diesem Staatsgebilde?
Den Staatspreis, den er 1989 erhalten sollte, lehnte er ab: „Starre, Dialogunfähigkeit und Intoleranz“, und das war es dann… Dagegen lag seine Meisterschaft in der gedanklichen Beweglichkeit, im Überblenden, in der dialogischen Mehrdeutigkeit, wie er sie großartig vorführte in „Das Leben des Jean Paul Friedrich Richter“ (1975) in einer Passage über die Zensur – im Biedermeier!
Nun hat er – als Bilanz, Lebensepilog? – noch einmal einen Roman vorgelegt:
Günter de Bruyn, Der neunzigste Geburtstag, Ein ländliches Idyll, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2019, 272 Seiten, 22 Euro
Der Autor, im Leben, wie im Buch der Erzähler, ist Bibliothekar und verbringt seine „alten Tage“ in Wittenhagen, einem märkischen Dorf, mit seiner Schwester, einer APO-Veteranin, deren 90. Geburtstag ansteht. Der sprachbewusste Bibliothekar kann den neuen Marketing – und Digitalslang nicht ertragen und wir hören seinem Nörgeln auf hohem literarischen Niveau genauso gepeinigt zu. Er krümmt sich fast bei Slogans wie „Ehe für alle! Keine Obergrenze!“ und der Mahnung „Wir sind alle Ausländer!“, versteht auch nicht, dass aus der alten Reithalle ein „Climatic Spa“ werden soll. Das Gender Mainstreaming empfindet er als Zumutung. Dabei spielt de Bruyn mit den Namen: Er selbst heißt Leonhardt Leydenfrost, eine Abgeordnete der neuen Ökopartei heißt Grünlich, eine geistig sehr schmal ausgerüstete Journalistin trägt den Namen Schmalfuß, sie erscheint zu einem Fernsehinterview mit einem „location scout“- genug, genug, er sieht und hört dem allem melancholisch zu, nicht mit allzu viel Ressentiments geladen, eher kopfschüttelnd erheitert. Bezwingend schöne Schilderungen eines Heilig-Abend-Gottesdienstes und eines Ostergottesdienstes zeigen das erzählerisch glänzende Vermögen des 90jährigen. Als gegen Ende noch eine Buchhändlerin aus Berlin-Dahlem ins Erzähl-Spiel eintritt, die treue Lebensgefährtin seines eigentlich „verlorenen Sohnes“ und die legendär gewordene Schwester an ihrem 90. Geburtstag stirbt, verknäueln sich alle Erzählfäden zu einem bunten und sehr schönen Stück Literatur, für das man dem alt und weise gewordenen Günter de Bruyn nur danken kann! Und da ihn mit der Schleicherschen Buchhandlung eine liebevolle Freundschaft verband, verabschieden wir ihn mit einem Wort des alten Leydenfrost, „…als er… unvermittelt noch einmal seinen Zitatenschatz bemühte:
‚Des Leibes bist du ledig, Gott sei der Seele gnädig’“.
„Üb-ersetzen“ hat Karl Kraus allen empfohlen, die sich im Übersetzen engagieren, ihr Patron und Beschützer ist seit langem der Gott Hermes; listig ist der „gerissenste aller Götter“ (Plutarch) auf den Märkten und Wegen dieser Welt zu Hause. Ein Gott der Schläue mit Neigung zu List und Tücke, Freund der Händler und Glücksspieler, der Übersetzer und Übersetzerinnen, von denen Dorothea Trottenberg und Elisabeth Edl zur Zeit höchstes Lob erhalten. Es ist Elisabeth Edl zu verdanken, dass eine Neuausgabe der Education sentimentale von Gustave Flaubert vorliegt:
Gustave Flaubert, Lehrjahre der Männlichkeit, Geschichte einer Jugend, Roman, aus dem Französischen von Elisabeth Edl; Hanser Verlag, München 2020; 800 S., 42 Euro
Fairerweise gehörten zu diesen Angaben die Nennung die 70 Seiten „Nachwort“ – eine brilliante Studie für sich – und 150 Seiten Anmerkungen geradezu so enzyklopädischer wie angenehmer Gelehrtheit. Die „gelungenste Klassiker-Ausgabe, die es hierzulande zu kaufen gibt“, schwärmt ein Kritiker in der ZEIT. Erschienen 1869, wurde der Roman zwischen 1914 und 2001 zehnmal ins Deutsche übersetzt mit insgesamt sieben Titelvarianten. „Üb-ersetzen“, Karl Kraus sei Dank! Die Untersuchung Elisabeth Edls zu Titel und Titeln ist ein philologisches Medaillon der besonderen Sprachklasse!
Von den vier Romanen Flauberts – Madame Bovary, Salambo, Bouvard und Pecuchet sowie der Educatin sentimentale – trägt er keinen Personennamen, will dagegen eine männliche Jugend zwischen 1840 und 1851 in Frankreich abbilden unter intensiver Einbeziehung der historischen Umstände, vor allem der „Revolution“ von 1848. Es muss die sprachliche Eleganz Elisabeth Edls sein, die den Text gänzlich unromantisch, dagegen sehr straff, knapp, ungezügelt mit seufzender Ironie und kopfschüttelnden Pointen dahinstürmen lässt. Henry James, ein großer Erzähler, fragt mit vollem Recht angesichts der Lektüre: „Why, why him?“. Die Hauptperson Frederic Moreau ist ein verwöhnte Jüngling, „der sein Liebesglück aus Tölpelei und Charakterlosigkeit zuverlässig vermasselt“, so noch heute eine verärgerte kritische Stimme, „eine lasche Lusche“. Die gnadenlose Schärfe, das illusionslose Spiegelbild, die gallige Verachtung, mit der Flaubert seine Zeit sieht und das bewundernswerte Ensemble seiner Figuren reden lässt, lässt keine Unterbrechung beim Lesen zu! Der Roman verlangt, wie sein späterer Kollege Marcel Proust forderte, „Tage des Lesens.“
Mit den Anmerkungen – 150 Seiten – ließe sich ein Romanistik-Studium gut beginnen. Selbst wer den Roman im Regal steht hat, wird einem völlig neuen Buch begegnen, nämlich den „Lehrjahren der Männlichkeit“, die literarischste Didaktik des 19. Jahrhunderts – stilvoll, einsichtsreich, sehscharf, antiromantisch, aufgeklärt, mitleidlos und liebevoll zugleich. Die „Lehrjahre“ können zum „Lehrlesen“ werden.